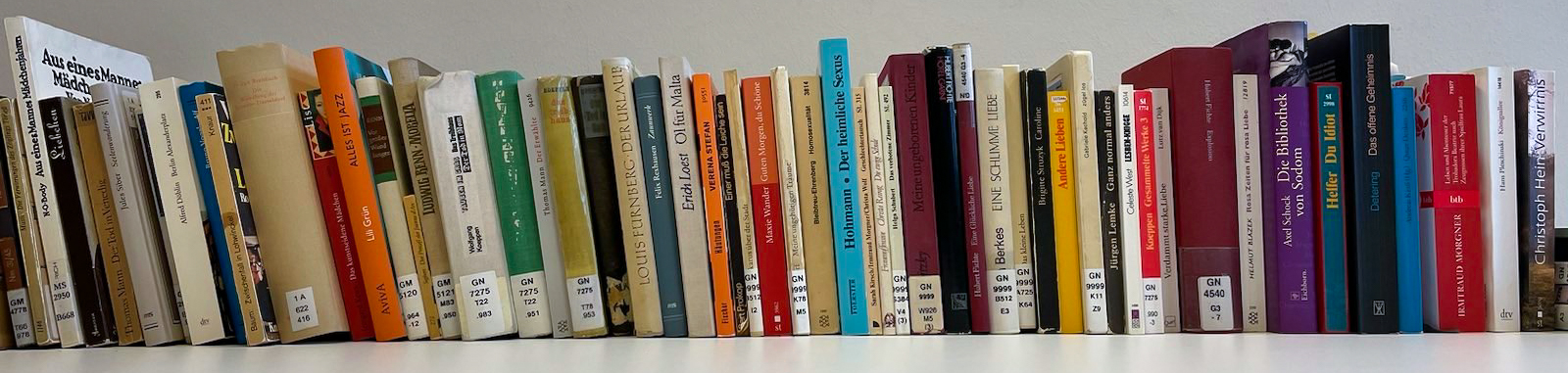
Willkommen auf der Seite des Forschungsprojekts „Queer Reading – eine Methodologie. Deutsche Literatur im Zeitalter des § 175“.
Diese Seite befindet sich derzeit im Umbau und ist voraussichtlich ab Ende Mai 2024 wieder verfügbar.
Aktuelle Informationen rund um das Projekt finden Sie auf den Seiten der Forschungsstelle Kulturgeschichte der Sexualität an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Das Kolloquium „Queer Reading. Lektüren und Methoden“ für Doktorand:innen sowie Interessierte findet am 15.05., 29.05., 26.06 sowie 10.07.24 statt. Für weitere Informationen oder bei Interesse an einer Teilnahme wenden Sie sich gern an liesa.hellmann@hu-berlin.de.
Im Sommersemester 2024 bieten wir an der Humboldt-Universität verschiedene Lehrveranstaltungen zum Thema Queer Reading im Bachelor, Master sowie als studentisches Projekttutorium an.