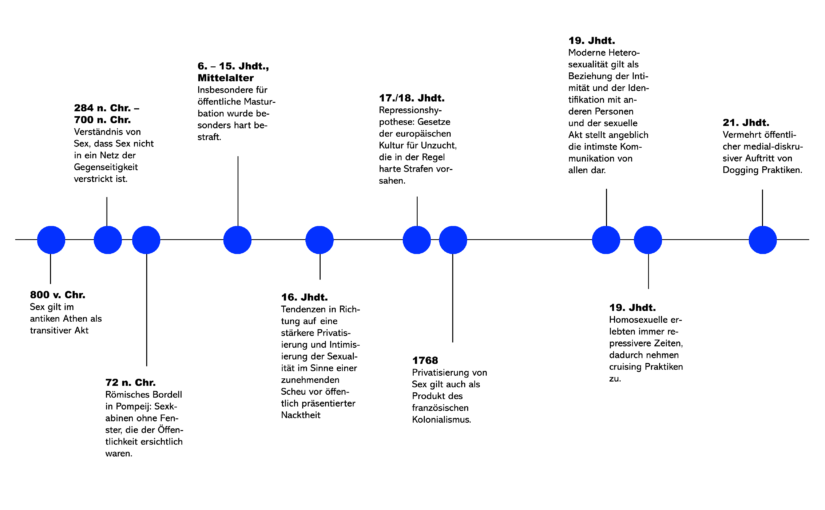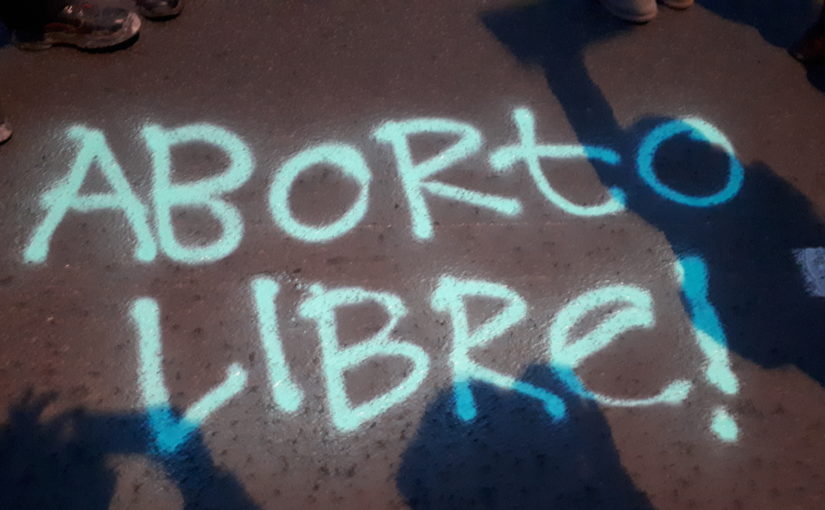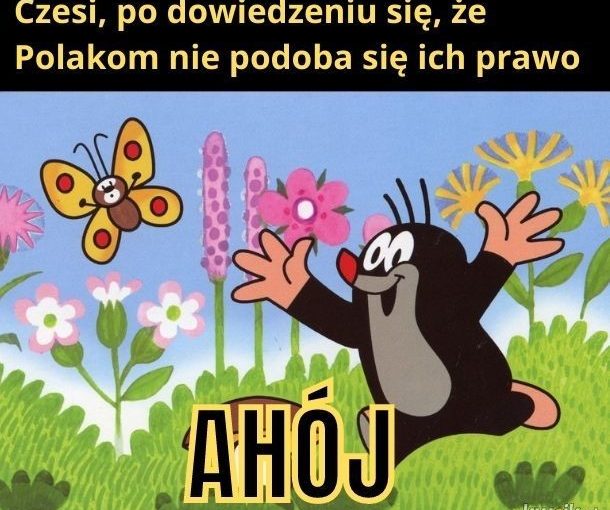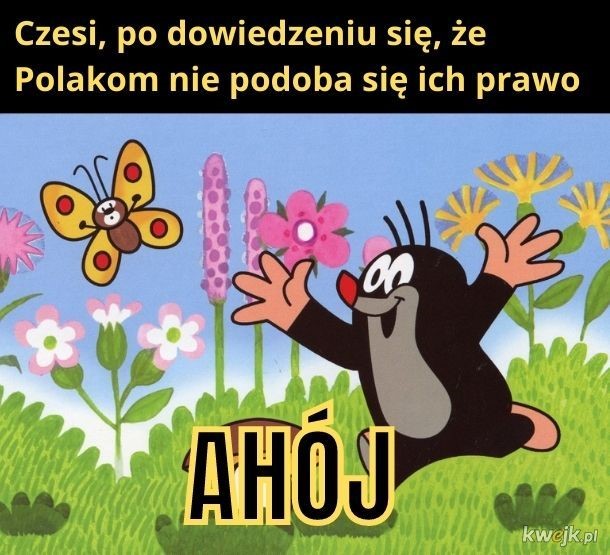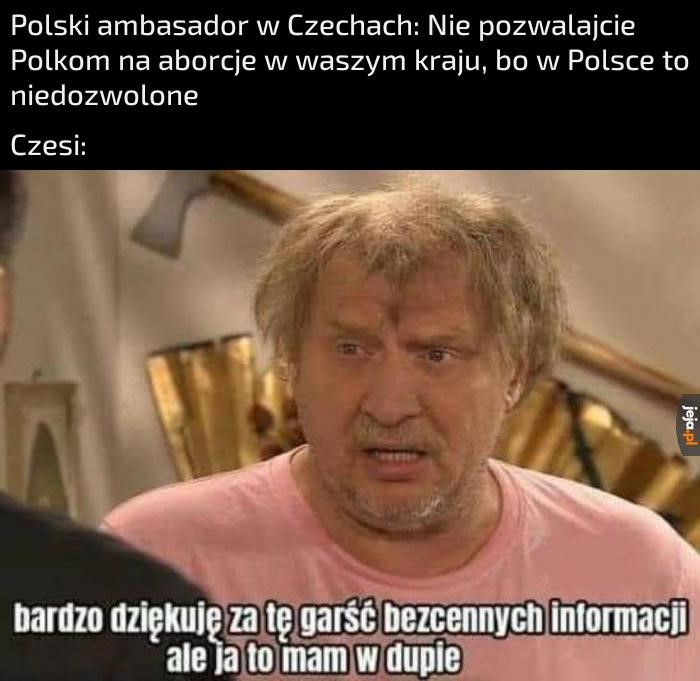Interviewtranskript von Jérémy Geeraert.
Jochen wuchs in einer gutbürgerlichen Familie im Ruhrgebiet auf. Sein BWL-Studium brach er kurz nach Beginn wieder ab, entschied sich für die Schifffahrt und machte eine Ausbildung zum Schiffskapitän. Obwohl es nach seiner Ausbildung zunächst leicht war, Arbeit zu finden, hat sich die Situation seit der Finanzkrise von 2007 verschlechtert. Nachdem er seinen Job als Offizier in einer großen Reederei verloren hatte, fiel er in eine mehr als drei Jahre andauernde Arbeitslosigkeit, die lediglich von Gelegenheitsjobs auf Touristenbooten unterbrochen wurde. Im Jahr 2019 hörte er eher zufällig, dass NGO-Boote, die im Mittelmeer Seenotrettung betreiben, Kapitän*innen suchten. Die Suche nach einer Anstellung blieb zwar erfolglos, er konnte sich jedoch freiwillig als Kapitänsmattführer an einer Rettungsmission beteiligen. Jochen war an der Rettung von 104 Menschen beteiligt, die versuchten, Europa mit einem Schlauchboot zu erreichen.
In den Auszügen aus dem Interview, das mit ihm für das CrimScapes-Projekt geführt wurde, werden die Auswirkungen der Kriminalisierung im Bereich der humanitären Seenotrettung deutlich.
I. Der Weg auf das Schiff: „Das Sinnvollste, das man mit einem Kapitänspatent machen kann“
[…] Interviewer: Erst mal, bevor du von [der NGO] gehört hast, was hast du vorher von Seenotrettung schon gehört?
Jochen[1]: Ja, so am Rande hab’ ich das halt immer wieder mitgekriegt, dass das hier ein großes Problem ist, und als ich dann hier das Jobangebot gekriegt hatte, da war das gerade mit der Carola Rackete aktuell gewesen, das war eigentlich genau der Zeitpunkt dann.
I: Hast du das verfolgt?
J: Das hab’ ich verfolgt, natürlich.
I: Wie hast du das wahrgenommen, wie findest du das?
J: Also ich hab’ allergrößten Respekt vor dem, was die Frau da geleistet hat und gemacht hat, und um ehrlich zu sein, möcht’ ich momentan nicht mit ihr tauschen. So in der Öffentlichkeit zu stehen. […]
I: Und ist das für dich, ist das sozusagen ein Job?
J: Ja, das ist einmal aus Hartz IV raus, aber ich betracht’ das auch irgendwie so als Sechser im Lotto, irgendwie dann letzten Endes, dass es ein Job ist, den man wirklich gerne macht, und was irgendwie das Sinnvollste ist, was man mit einem Kapitänspatent so machen kann. Also besser als da nur Blechkisten hin- und herzufahren.
I: Und kannst du dich noch erinnern, was du gedacht hast, als diese Anfrage kam? Was hast du dir da für Fragen gestellt oder was waren da deine Erwartungen und Vorstellungen?
J: Ja, ich war, wie gesagt, eigentlich sofort begeistert gewesen davon. Also, hab eigentlich kaum drüber nachgedacht, und dann halt ein bisschen mal nachgelesen, wie das von der rechtlichen Situation aussieht. Also ich hatte ja nicht unbedingt vorgehabt, mein Patent zu verlieren deswegen, aber .. da das bis jetzt..
I: Das kann man nicht verlieren?
J: Ist bis jetzt noch nicht irgendjemand für verurteilt worden, für die private Seenotrettung. So alle Gerichtsverfahren, die sind mit Freisprüchen geendet. […] Also was wir machen, das ist halt durch Völkerrecht sogar zwingend, mehr oder weniger. Wenn man da mit’m Schiff unterwegs ist und von ‘nem Seenotfall Kenntnis kriegt, dann muss man helfen. Und das schlägt halt irgendwelches nationales Recht und irgendwelchen Salvini-Dekreten unten, und da steht das drüber, insofern mache ich mir da keinen Kopf. […]
II. Auf dem Meer: „Chaos auf der Seekarte“ oder Retten zwischen Warnschüssen, Grenzlinien, Dekreten und Sturmwarnung
I: Du hattest ‘ne klare Aufgabe, ja?
J: Genau. Ja, das war die Aufgabe, die ich dann mehr oder weniger übernommen hab’. Also offiziell ist das dann nie so wirklich geregelt worden, aber ich bin praktisch nach Frühstück auf Brücke hoch und bin vor’m Schlafengehen dann von der Brücke runter. Einfach weil die Anderen entsprechend mehr Erfahrung hatten, was die Gästebetreuung angeht, hab’ ich denen dann eben den Rücken freigehalten, so hab’ ich meine Rolle hier gesehen dann.
I: Die [Helene (Name des Schiffes)] ist da also das erste Mal auf Mission gefahren. Wann ist sie losgefahren?
J: Zwei Wochen waren wir unterwegs. Es sind halt erst .. vom.. oder ich bin in Barcelona eingestiegen, da haben wir den Dampfer noch so ein bisschen klargemacht, ein paar Reparaturen noch gemacht, was noch nicht so ganz fertig war. So die Trinkwasseranlage und so weiter, da musste ein bisschen so ein Pfusch behoben werden. Sind dann losgefahren, haben dann in (…Cagliari…) nochmal Zwischenstopp gemacht, nochmal nachgetankt, dann so’n paar Sachen noch behoben, die immer noch nicht funktioniert hatten, sind von da aus dann bis kurz vor Libyen, vor Tripolis – Tripolis, ne? – gefahren und haben uns da außerhalb der 24 Meilen Zone postiert, äh, auf dem Weg dahin schon das erste abgesoffene Schlauchboot gesehen, das also wirklich nur noch an einer Kammer hing.
I: Ohne Menschen.
J: Ohne Menschen drauf, ohne irgendwie ‘ne Markierung, dass die einer abgeborgen hatte. Die Leute sind.. abgesoffen, auf gut Deutsch.
I: Wie groß war das?
J: Ja, auch so ein Schlauchboot, wie wir letzten Endes aufgenommen haben, 80, 100 Leute mögen das vielleicht gewesen sein. Schwamm da so, der Vogelscheiße nach, die da drauf war, schon seit zwei, drei Tagen wohl schon.. Ja, wir sind dann hinterher auf unsere Beobachtungsposition gefahren, weil wir haben ja eine Beobachtungsmission und keine Rettungsmission offiziell gemacht. Das darf man als private Motoryacht nämlich nicht. Äh, haben ‘n Notruf erhalten, also eine Positionsmeldung von so ‘nem Schlauchboot, sind nachts hingefahren, haben drei Stunden lang gesucht, haben aber nichts gefunden, wieder zurück auf Position, kaum da angekommen, die nächste Position gemeldet gekriegt.
I: Von dem gleichen Schiff, von dem gleichen Boot.
J: Nee, von ‘nem anderen Boot, das war wohl ein Schlauchboot mit 86 Leuten, darunter Frauen, Kinder drauf, das hatten wir eigentlich gesucht und haben dann halt unser Boot gefunden. Also was aus dem anderen Boot geworden ist .. kann man auch nur spekulieren.
I: Das weiß man nicht.
J: Das weiß man nie.
I: Und, unser Boot heißt..? Was war das für’n Boot?
J: Ja, das war halt so’n Gummiboot, irgendwie so zehn Meter lang, sag ich jetzt mal, (…). Kaputten Außenborder, kein Trinkwasser mehr an Bord, die erste Luftkammer war schon kaputt, die zweite Luftkammer ist kaputt gegangen, als wir angefangen haben, die Leute abzubergen, also so zwei, drei Stunden später wären die auch abgesoffen gewesen. […]
I: Und also kannst du nochmal beschreiben, die Besatzung an Bord, wie viele Leute waren das, was für Leute, mit was für Aufgaben?
J: Also losgefahren sind wir letzten Endes mit, lass mich nichts Falsches sagen, sieben. Der Kapitän, der erster Offizier, ich als zweiter, Georg als dritter, einen Arzt hatten wir dabei, eine Köchin und zwei Reporter.
I: Reporter – von?
J: Freischaffend.
I: Freischaffend.. wieso hatten die einen Auftrag für..?
J: Ja, die hatten einen Auftrag, die haben uns begleitet, die haben aber auch mitgearbeitet. […]
I: Und die Medien, was haben die für eine Funktion an Bord? Warum fahren die jetzt mit als Medienleute?
J: Na, einmal um zu berichten halt, um über die Situation zu berichten, was hier überhaupt im Mittelmeer abgeht. Darauf aufmerksam zu machen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war auch froh, dass die dagewesen sind, weil das einfach so ein bisschen Sicherheit vermittelt hat.
I: Ja, in welcher Form?
J: Also als wir das Schlauchboot dann abgeborgen haben, die Leute da runter genommen haben, da kam ‘n Schnellboot von der libyschen Küstenwache. Und das gab halt auch so Situationen, wo die dann schon mal Warnschüsse abgegeben haben, auf solche NGO-Boote. […]
I: Das ist aber bei euch jetzt nicht passiert?
J: Das ist bei uns nicht passiert.
I: Wie ist das abgelaufen, wie die kamen? Und dann?
J: Ja, die sind halt angekommen (atmet aus), mit Vollkaracho auf uns zugehalten, sind dann relativ dicht an uns rangefahren, eigentlich schon ziemlich zu dicht, wenn man mal den Zustand von dem Schlauchboot bedenkt, das hätte das also durchaus volllaufen lassen können, in den Moment. Und dann ist es natürlich schön, wenn da irgendwo einer mit Kamera das Ganze filmt, und auch zu sehen ist, dass da irgendwie Webcams oben auf dem Dach sind, und wo man sich denken kann, dass das dann auch live gestreamt wird.
I: Also Beweismittel sichern.
J: Beweismittelsicherung, für den Fall, dass sie doch noch irgendwie ausgeflippt wären, da.
I: D.h. auch, dass man da selber, dass das, was du selber machst, auch festgehalten gehört, ist auch ‘ne Sicherheit, ne?
J: Das wohl auch, ja. Und eine schöne Erinnerung, davon mal abgesehen.
I: Ja, ja. Ja, wie lange hat diese Rettungsaktion gedauert, bis die alle an Bord waren?
J: Ja, so eine halbe Stunde, Stunde. Wir haben erst mal das Schlauchboot vorgeschickt, Schwimmwesten draufgepackt. Wir sind ja eigentlich davon aus gegangen, dass das Boot mit den knapp 80 Leuten, die haben die Schwimmwesten erst verteilt, sind dann aber wieder zurückgefahren, weil das eben zu wenig gewesen sind. In der Zwischenzeit haben wir uns der Position dann noch genähert, wollten die Leute halt dann einzeln, über unser Schlauchboot halt an Bord bringen, einfach damit das ein bisschen ruhiger abläuft. Wenn da jeder über Kante klettern will, hier an Bord klettern will, dann ist das .. so’n ein Boot natürlich schlecht ausgetrimmt und kann auch schon mal umkippen. […]
J: Bloß, als dann halt die Küstenwache kam, da haben wir das auch mehr oder weniger ignoriert, das Boot wirklich längsseits gezogen, mit Bootshaken, die dann über Reling klettern lassen, damit das schneller geht. […]
J: Also ‘ne Öse eingepickt, zwischendurch ist dann das Gummi da auch gerissen, wo ich das festgehalten hatte. Also das als Gummiboot überhaupt zu bezeichnen, das ist schon ein bisschen ein Euphemismus, das war besserer Zeltstoff, sag ich mal.
I: Was für Leute sind da auf dem Boot gewesen? Kannst du das sagen?
J: Ja, insgesamt 109. Da waren zwei Ägypter waren da dabei, das waren Sudanesen, und das waren – lass mich nichts Falsches sagen – Libyer, glaub’ ich, aber da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Der Jüngste war dreizehn, seit einem Jahr alleine unterwegs gewesen, und das ging so bis .. fast Anfang 30 Jahren, würde ich sagen, fast alles junge Männer. […]
I: Und wie kann ich mir das hier vorstellen, auf dem Schiff, mit so vielen Menschen? Wo waren die alle?
J: (lacht leicht) Alle an Deck.
I: Wie groß ist das Schiff, wie lang ist das?
J: 25 Meter lang und ungefähr fünf Meter breit. Die Hälfte davon sind Aufbauten. Also rein rechnerisch gesehen haben wir knapp unter einem halben Quadratmeter pro Person. Und entsprechen eng kannst du dir das dann halt vorstellen.
I: Ja. Also die waren da alle vor allem an Deck, ja?
J: Die waren ausschließlich an Deck. Also in den Aufbauten, da mussten wir natürlich entsprechend arbeiten, Essen zubereiten, da konnten wir keinen der Leute herumsitzen haben. Bloß halt am Schluss, in der Sturmnacht, wo das Wasser einen halben Meter an Deck stand, da haben wir die dann natürlich mit reingenommen, sonst wären die über Kante gespült worden.
I: Das musst du mir nochmal ein bisschen mehr erklären. Was ist da passiert? Also ihr habt die alle an Bord genommen, so um jetzt mal in der Reihenfolge zu bleiben, und seid .. wo seid ihr hingefahren?
J: Wir sind dann erst mal Richtung Malta gefahren, haben versucht, da reinzukommen. Haben keine Einlaufgenehmigung gekriegt.
I: Ja, wie lang hat das gedauert?
J: Insgesamt neun Nächte waren das.
I: Also acht Nächte waren die insgesamt an Bord?
J: Genau, und so einen Tag haben wir ungefähr bis Malta gebraucht. Also ‘ne Woche halt davor herumgetrieben. […] Peinlich darauf geachtet, dass wir halt nicht die Zwölf-Meilen-Zone reinlaufen. Sind dann an dem Tag weitergefahren Richtung Italien, weil da für die nächsten zwei oder drei (…Tage…) ‘ne Sturmwarnung kam, das war ein bisschen geschützter. Und der Sturm, der hat uns halt dann auch nachts erwischt.
I: Ja, nach wieviel Tagen?
J: Ja, die neunte Nacht, wie gesagt, da konnten wir dann auch gar nicht mehr anders als weiter nach Italien zu fahren, weil der Wind aus südlicher Richtung kam. Und wir sind halt so gefahren, dass wir möglichst wenig Angriffsfläche geboten haben, also immer mit dem Wind..
I: Weil halt die Leute an Bord waren.
J: Weil die Leute an Bord waren. Damit das Schiff ein bisschen ruhiger wird, da teilweise dann noch ein bisschen aufs offene Meer oder weniger, wenn irgendwie ‘ne Windböe gekommen ist, den Kurs geändert. Das sah hinterher recht chaotisch aus, auf der elektronischen Seekarte. .. Ja, es war sieben, acht Windstärken, wie gesagt, Wasserstand so ungefähr einen halben Meter an Deck, wo die Leute gesessen haben, alle, und das war dann wirklich der Zeitpunkt, wo das alles zum Seenotfall auch für uns geworden ist. Weil das war ein unhaltbarer Zustand, ne, da mussten wir einlaufen.
I: Also es gab keine Erlaubnis, von der italienischen Küstenwache?
J: Es gab keine Erlaubnis, wir haben uns also angekündigt, haben gesagt, wir kommen rein, und wenn wir keine Erlaubnis kriegen, dann deklarieren wir uns eben als Seenotfall, dann wird uns die italienische Küstenwache halt retten müssen, wär’ die zu verpflichtet gewesen. Die sind da, ja (lacht) wir hatten ja auch, dieses Mal ja hatten wir auch ein Salvini-Dekret sogar gegen uns. Also an dem Tag, wo die Regierung aufgelöst wurde, da hat der Salvini quasi nochmal ein Dekret geschrieben, um uns unter einer Strafandrohung von einer Million verboten einzulaufen. Äh, ja (schmunzelt), sag ich jetzt mal, amüsier’ mich köstlich da drüber. Wir sind hier, Salvini ist weg. Ja, wie gesagt, wir haben uns halt angekündigt, über Funk entsprechend Kontakt gehalten, die haben uns ein Boot entgegengeschickt, von der Guardia Financia, die haben hier die Zustände an Bord gesehen und haben dann eingesehen, dass sie uns in Hafen reinlassen müssen. Also schlussendlich haben wir dann doch eine Einlaufgenehmigung gehabt.
I: Und, äh, warum ist das Schiff dann konfisziert?
J: Puhhh…
I: Was ist der Vorwurf, wenn, wenn die euch haben einlaufen lassen?
J: Na, so ganz genau wirste das dann auch die Juristen fragen müssen, weil wir haben halt gegen dieses Salvini-Dekret konkret verstoßen.
I: Nun ja, o.k.
J: Wobei, wie gesagt, wir haben streng nach Völkerrecht gehandelt und Völkerrecht steht über nationalem Recht.
III. An Deck: Notversorgung und Freizeitprogramm
I: Also nochmal ganz kurz zurück bevor wir einlaufen. Ähm, wie ist das, wie kann man sich das hier vorstellen, an Bord, die Woche, wo ihr so voll wart? Wie ist das abgelaufen, was ist das passiert? Wie sind die Tage vergangen? Wo wurde geschlafen, wie wurde gegessen.. gab es medizinische Versorgung? Kannst du das alles kurz ein bisschen beschreiben?
J: Na, die Leute, die haben halt den ganzen Tag an Deck gesessen. Natürlich auch so gut wie gar nichts zu tun gehabt. Wir haben ja versucht, jeden Tag mal so einen Höhepunkt zu setzen. (…War’s…) immer einen Tag ‘ne Dusche aufgebaut für die, dass da jeder Mal zwei Minuten duschen konnte, mit Glocke vorne, Glocke Ende, frische Klamotten ausgegeben. Einen Tag mal die Leute mit unserem Schlauchboot mal so’n bisschen durch die Gegend gefahren .. so’n.. als Actionprogramm, sag ich mal, mehr oder weniger, um die Zeit totzuschlagen. Einen Tag hatten wir mal so’n paar Spielkarten rausgegeben, wobei das allerdings ein bisschen Streit an Deck gegeben hatte, .. was zur Folge hatte, dass die Gäste die Karten halt selber eingesammelt hatten, weil die halt möglichst ruhig wollten und keinen Ärger mit uns haben wollten. Essen (atmet aus), Couscous, morgens und abends, ist halt das einzige, was man mit so einem normalen Herd, einem normalen Küchenherd zubereiten kann, für hundert Leute. Sprich: jeweils drei Kilo, waren das, glaub ich, in so einen zehn Liter Putzeimer, Heißwasser drauf, und das Ganze dann mit Bohnen, mit Thunfisch, mit Schokolade, wie auch immer ein bisschen Geschmack reingebracht; jeweils ein Plastikbecher voll, morgens und abends. So’n bisschen was an Müsliriegel, Energieriegel, mal gab’s ‘n halben Apfel dafür. Also ‘ne Notversorgung gemacht, dass sie die nötigen Kalorien hatten. Äh, ärztliche Versorgung haben wir gehabt, wie gesagt, ein Doc an Bord, der hat einmal am Tag Sprechstunde gehabt.
I: Hatte der zu tun?
J: Ja, der hatte zu tun. Der hat dann auch hier gesessen, hat entsprechend Wartemarken verteilt .. und hat die Leute dann hinterher.. versorgt.
I: Da gibt’s extra ‘ne kleine Krankenstation, das hat er dort gemacht, ne? In diesem kleinen Raum?
J: Genau, wir haben hier so ein kleines Hospital, wo .. mit den wichtigsten Medikamenten ausgestattet. Entsprechend zur Wundversorgung und die zu erwartenden Sachen, also Krätzemedikamente z.B., gegen Husten, gegen Erkältung, (…) Schmerzmittel.
I: Gab’s Probleme mit Seekrankheit?
J: Ja.
I: Gab es, unter den Gästen?
J: Also einer, der ist wohl wirklich die ganze Zeit seekrank gewesen, hat da aber auch nicht so wirklich mit rausgerückt, hat’s nur für sich behalten.
I: Und .. wo wurde geschlafen?
J: Also geschlafen wurde dann letzten Endes an Deck. (Atmet aus) Und nachts haben wir dann entsprechend auch Radar und Satellitenantenne ausgemacht, dass man hier oben auf den Aufbauten schlafen konnte. Dann auf der Vorpiek, sonst wär das halt Strahlungs-mäßig nicht gegangen. Dann haben wir da auf der Vorpiek so’n Mast mit ‘ner Aussichtsplattform, dann haben die Leute da drauf geschlafen, festgeschnallt, dass sie nicht runterfallen. Unsere Gangway haben wir mit Schwimmwesten ausgepolstert, dass man darauf liegen konnte, also jeden verfügbaren Quadratmeter. Einer hat immer in unserem kleinen Dingi geschlafen.
I: Also, also so nacheinander? Kann man das so sagen?
J: Ja, jeder hat wohl irgendwie seinen festen Platz gehabt, die ganze Zeit über, das hat sich dann wohl so eingespielt gehabt, die hatten auch so ein bisschen ihre Hierarchie untereinander gehabt.
I: Aber unter freiem Himmel?
J: Unter freiem Himmel, die ganze Zeit über. Also wir haben so ‘ne Plane als Sonnenschutz gespannt .. aber anders ging’s nicht. Gerade nachts, da konnte man also wirklich nur als Balerina quasi da übers Deck laufen. Weil ‘n Schritt, und dann irgendwie auf Zehenspitzen, und dann n’Schritt zur Seite, wo der nächste Platz ist, wo man den Fuß dann hinstellen..
I: Um einen Weg da durch zu bekommen..
J: Sich da überhaupt durchbewegen zu können und im Zweifelsfall mal nachts auf’s Klo gehen zu können, .. nach vorne.
I: Wie war denn die sanitäre Situation gelöst?
J: (atmet aus) Ja, eine Katastrophe an und für sich. Also wir haben halt das eine Außenklo, so ‘ne Metallwanne mit Loch und Abflussrohr, ‘n Gartenschlauch zum Nachspülen, da als Sichtschutz ‘ne Plane rumgestellt. Selbst hinter der Plane, da haben sogar zwei Leute geschlafen, obwohl das gestunken haben muss wie Sau, und da die ganze Zeit .. bei hundert Leuten, da tritt öfter mal einer aus. Das waren sogar noch die bevorzugten Plätze, so wie man das mitgekriegt hatte, weil da halt ein bisschen mehr Platz war.
I: Gab es sowas wie einen festen Tagesablauf? Gab’s da ‘ne Organisation?
J: Ja eigentlich nur die festen Mahlzeiten, und auch die waren halt so ein bisschen davon abhängig, wie wir das halt organisiert gekriegt haben.
I: Und für euch als Team, gab es so einen Schichtplan ?
J: Genau, wir hatten einen Schichtplan, einen festen Wachplan, also nachts jeweils vier Stunden, tagsüber drei, dass die einzelnen Schichten auch untereinander gewechselt haben, dass nicht jeder immer von Mitternacht bis vier, oder so, muss, also einmal die Wache und dann die nächste von 20 bis Mitternacht. […]
J: Ja, war vor allem anstrengend. Temperaturen immer 30 Grad, kein Wind, Deck voll, bisschen am Muffeln, um es vorsichtig auszudrücken. Wenn man da hundert Leute sitzen hat, die seit Wochen, Monaten nicht geduscht haben, dann fällt das durchaus auf. […] Und ansonsten halt, von morgens bis abends auf Wache gewesen. Kaum geschlafen.., also wenn ich Glück hatte waren das dann mal sechs Stunden, teilweise auch weniger, wobei vor allem Caro und Georg eigentlich nicht viel mehr auf mehr als zwei Stunden pro Nacht gekommen sind, die halt die Gästebetreuung hauptsächlich gemacht haben. Da habe ich noch fast den glücklichsten Job hier an Bord gehabt, muss ich fast sagen.
I: Ja. Und dann die Situation hier an Bord, wie hast du das wahrgenommen, was ging dir durch den Kopf, was hast du da gefühlt? Was kannst du, kannst du dich daran erinnern?
J: Puhhh .. also ich war froh, dass wir die Leute an Bord hatten. Das war so wirklich ‘ne gute Sache, was wir da gemacht haben, wenn wir die nicht an Bord genommen hätten, wären die abgesoffen gewesen. Das war mir auch die ganze Zeit über entsprechend klar gewesen. Entsprechend war ich auch mehr als gerne bereit entsprechende Unannehmlichkeiten, nenn ich’s jetzt mal, in Kauf zu nehmen. Es war wohl mit das härteste, aber sicherlich auch das beste, was ich jemals gemacht hab’.
I: Jemals in deinem Leben, meinst du?
J: Ja. Wie gesagt, irgendwo mehr als ein Job. (schmunzelt)
IV. Im Hafen: Routinearbeiten und Szenarien der Entkriminalisierung entwerfen.
I: So, dann gehen wir hier mal weiter ein bisschen mehr in Richtung Kriminalisierung. Was würdest du sagen, wie wäre die Mission abgelaufen, wenn die Arbeit nicht kriminalisiert worden wärt?
J: Wir hätten die Leute hier abgeladen, das Schiff wieder ausgerüstet und wären wieder losgefahren.
I: Wie lange hätte das gedauert?
J: Puhh, drei, vier Tage vielleicht.
I: Also vielleicht zwei oder drei Rettungen statt einer, kann man so sagen?
J: Ja, ich sag mal, im Grunde, optimal wär’ ein Pendelverkehr gewesen. Leute einsammeln, in’n Hafen, Leute abladen, Proviantübernahme und alles klargemacht wieder, und wieder losgefahren. […]
I: Hmm, ja. Hmm. So, dann kommen wir mal zu der Zeit hier, in [Hafenstadt in Sizilien]. Was ist deine Aufgabe hier auf dem Schiff im Hafen?
J: Auf das Schiff aufzupassen. Einmal, dass hier nicht sizilianisch eingekauft wird. Es sind ja noch gewisse Wertgegenstände, die Satellitenanlage hat 40 000, glaub ich, gekostet.
I: Also, dass nichts geklaut wird.
J: Dass nichts geklaut wird, das Schiff am Laufen halten, kleine Reparaturen. Und wir sind halt seitens des Hafens dazu verpflichtet, dass das Schiff entsprechend bemannt ist, dass man es notfalls versetzen kann und halt immer einer, mit entsprechender Kompetenz, sag ich jetzt mal, hier an Bord ist, um einfach angesprochen zu werden.
I: D.h. präsent sein. Was musst du auf dem Boot machen, konkret?
J: Ja, was muss ich konkret machen. Also am Laufen halt, entsprechend zusehen, dass hier immer Strom ist, den Generator offen halten, an- und abstellen.. das Ding, das regelmäßig gemacht werden muss, die (..Biltsch..) abzupumpen, immer (…Stoff Buchsen Schrott…), der Durchlass der Welle durch den Rumpf, da kommt immer so ein bisschen Wasser rein, das muss regelmäßig ausgepumpt werden. Und so kleine Routinearbeiten halt. Die Leinen kontrollieren, dass da irgendwie nichts bricht, so scheuert und Zweifelsfall wieder neu festzumachen. […]
I: Hmh. Hast du hier auch so Zeit auf dem Schiff, oder hast du die ganze Zeit zu tun?
J: Zeit hab ich eigentlich mehr als genug.
I: Mehr als genug.
J: Ja, viel zu viel. […]
I: Und, ähm, Zeit totschlagen nennst du das. Und wie empfindest du das?
J: Recht langweilig, mittlerweile. (schmunzelt)
I: Ähm, würdest du sagen, das ist ‘ne sinnvolle Arbeit, die du hier machst?
J: Puhh, also ich bin froh, dass ich wieder einen Job auf einem Schiff hab’, insofern ja, aber sinnvoll wär’, wenn wir jetzt wieder auslaufen könnten und wieder auf Mission gehen. […]
[1] Alle Namen und Orte wurden anonymisiert.